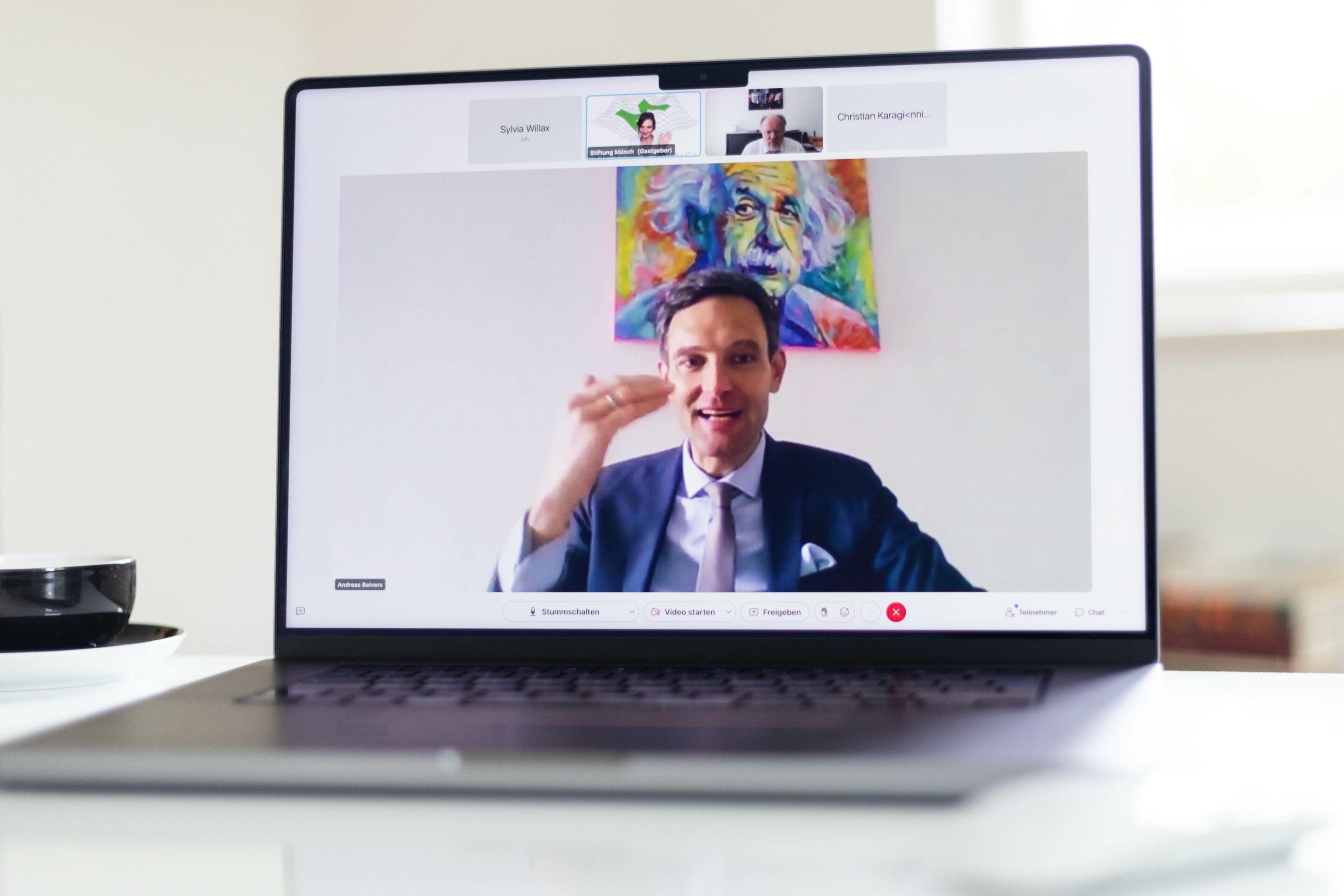Die Notfallversorgung, gemeinsam organisiert von den Kassenärztlichen Vereinigungen und den Krankenhäusern, gerät zunehmend an ihre Grenzen. Die Notaufnahmen an den Kliniken sind überfüllt, Patienten irren durch das System, Arztpraxen und Kliniken leiden zunehmend unter Personalmangel – mit der Konsequenz, dass sie die Notfallversorgung oft nur noch schwer aufrechterhalten können.
Es bedarf dringend einer Reform, wenn die Gesundheitsversorgung im Notfall weiterhin gewährleistet sein soll, die der Gesundheitsminister verspricht. Die vierte Stellungnahme und Empfehlung der Regierungskommission hat die Regelungsansätze im Bereich der Notfallversorgung auf ein neues Niveau gehoben. Die Zusammenarbeit der ambulanten und stationären Notfallversorgung in Integrierten Notfallzentren nimmt konkrete Formen an. Eine telefonische Ersteinschätzung könnte Kliniken entlasten. Doch um wirklich Erfolg zu haben, muss die Notfallversorgung intersektoral geplant und finanziert werden.
Können die Vorschläge der Regierungskommission diese Probleme lösen? Darüber diskutierten die Teilnehmer des Luncheon Roundtables der Stiftung Münch im Mai. Zu den Teilnehmern gehörten:
- Prof. Dr. Christoph Dodt, Chefarzt Klinik für Akut- und Notfallmedizin München Klinik Bogenhausen
- Martin Degenhardt, Geschäftsführer FALK (freie Allianz der Länder-KVen)
- Prof. Dr. Ferdinand Gerlach, Institut für Allgemeinmedizin, Goethe-Universität Frankfurt am Main
- Prof. Dr. Christian Karagiannidis, Geschäftsführender Oberarzt, Leiter des ECMO-Zentrums, Kliniken Köln
- Dr. Wulf-Dietrich Leber, Leiter der Abteilung Krankenhäuser, GKV-Spitzenverband
- Prof. Dr. Rajan Somasundaram, Ärztlicher Leiter Notaufnahme Campus Benjamin Franklin, Charité
sowie von der Stiftung Münch Professor Boris Augurzky, Eugen Münch, Professor Bernd Griewing, Professor Andreas Beivers und Annette Kennel.
Das übergeordnete Ziel der Regierungskommission: Durch eine bessere Steuerung sollen Notfallpatienten zielgerichtet in der für sie richtigen Versorgungseinheit Hilfe erhalten. So werden Ressourcen geschont, der Personalmangel im Gesundheitswesen abgefangen und die Versorgungsqualität verbessert. Damit dies gelingen kann, ist eine sektorenübergreifende Zusammenarbeit nötig. Die Chancen neuer Technologien müssen genutzt und eine Anpassung der Vergütung erfolgen.

Integrierte Leitstellen: Abschließende Ersthilfe und gezielte Steuerung
Ein zentraler Punkt der Stellungnahme ist der Aufbau von integrierten Leitstellen (ILS), die als verpflichtende erste Anlaufstelle für die Hilfesuchenden etabliert werden sollen. Sie sind unter den Notrufnummern 112 und 116117 erreichbar, die zwingend miteinander verbunden und Zugriff auf eine gemeinsame Datengrundlage haben müssen. Die Anrufe sollen durch geschulte Assistenten angenommen werden, die durch alle Möglichkeiten moderner Technologie unterstützt werden.
Die Hilfesuchenden werden damit fachkundig priorisiert und die weitere Versorgung passend eingeleitet. Besteht kein dringender Notfall, sollen sie die Wahl haben, einen Facharzttermin buchen zu lassen, ein Rezept zu erhalten oder dies selbst zu organisieren.
Die Ersteinschätzung und anschließende Steuerung in die richtige Versorgungsebene sei ein wichtiger Schritt und ein wesentlicher Erfolgsfaktor für eine Verbesserung der Notfallversorgung, zeigten sich viele Diskussionsteilnehmer überzeugt. Einige Teilnehmer betonten, dass es dennoch wichtig sei, die Selbsteinschätzung beim Patienten zu belassen, denn auch subjektives Empfinden führt bei den Betroffenen zu Unsicherheit und zu einer Ausnamesituation. „Es werden auch weiterhin Patienten in die Notaufnahmen gehen, das ist auch richtig“, so ein Diskutant. Man müsse zudem zwischen Beratungs- und Steuerungsfunktion unterscheiden, die zwar zusammenhängen, aber unterschiedlich seien, unterstrich er.

Verschränkung von 112 und 116 117: Gemeinsame Datennutzung, Einbinden moderner Technologien
Auch die Vernetzung der beiden Notfallnummern fand die Zustimmung der Teilnehmer, wenn auch einige betonten, dass die dahinterstehenden Organisationseinheiten getrennt bleiben sollten. Allerdings, so einige Teilnehmer, müsse auch der Rettungsdient als wichtiger Partner bei der Planung einbezogen werden: „Wir brauchen eine fachliche Verfasstheit, die den Prozess von Notfallpatienten gemeinschaftlich betrachtet. Der Rettungsdienst gehört zur Notfallmedizin und es ist wichtig, diese nicht auf das Krankenhaus beschränkt zu sehen.“ Er betonte die Notwendigkeit der fachlichen Fokussierung in der Notfallversorgung: „Nur wenn ambulante Spezialisten, Rettungsdienst und Krankenhäuser die Aufgaben zusammen betreiben, können Personalressourcen geschont und ineffiziente, doppelte Arbeit vermieden werden.“ Dies würde auch erlauben, innovative Techniken anzuwenden und zu etablieren.
Ein Teilnehmer berichtete einen häufigen Fall, der die Bedeutung der Zusammenlegung und gemeinsamen Datennutzung verdeutlicht: Ein Patient kontaktiert wegen Bauchschmerzen die 112, die einen Rettungswagen schickt. Hätten die Mitarbeiter Zugriff auf die Daten der 116 117, könnten sie sehen, dass der Patient dort bereits vor einer Stunde angerufen hat und auf der Warteliste für den Bereitschaftsarzt der KV steht. Sie könnten klären, ob sich die Beschwerden so verschlechtert haben, dass ein Rettungswagen tatsächlich nötig ist – oder den Patienten weiter um Geduld bitten. Ein Teilnehmer der Runde berichtete, dass in Bayern dieser gemeinsame Zugriff aller Disponenten auf die gleiche Datengrundlage nun umgesetzt wird.

Der gemeinsame Notfalltresen: Integrierte Notfallzentren an Kliniken
Ein weiterer Vorschlag der Regierungskommission: An den Kliniken der GBA-Notfallstufe 2 oder 3, bei Bedarf in Stufe 1 in dünn besiedelten Gebieten, sollen Integrierte Notfallzentren (INZ) eingerichtet werden. Diese sollen von KV und Krankenhaus gemeinsam betrieben werden. Doch, so die Kommission: Gibt es keine Einigung, soll das Krankenhaus das INZ leiten: „Wir waren der Meinung, dass man dann vorwärts kommt“, so ein Diskutant, der auch der Regierungskommission angehört. Die Patienten werden vom INZ aus wiederum zur passenden Einheit weitergeleitet – die Notaufnahme der Klinik oder zur KV-Praxis, die aber am Krankenhaus sein muss. Vorteile seien zum Beispiel die Möglichkeit, Geräte gemeinsam zu nutzen, und gemeinsam auf Personal zugreifen zu können. Bedarf der Patient keiner Behandlung in der Notaufnahme, soll er am INZ die Möglichkeit haben, einen Termin bei einer KV-Praxis vereinbaren zu können.

Hitzig wurde diskutiert, woher das Personal für das INZ kommen soll. „Wenn in der Notfallpraxis 24 Stunden ein KV-Arzt da sein soll, rechnet sich das nicht“, so ein Teilnehmer. Im Schnitt gäbe es 1,2 ambulante Notfallpatienten in der Stunde – ein KV-Arzt würde in dieser Zeit in seiner Praxis dagegen acht bis zwölf Patienten behandeln können. Er zeigte sich überzeugt, dass der Arzt nicht in der Klinik sitzen müsse, wichtiger sei es, dass jemand ansprechbar sei: „Der Patient darf nicht weggehen, ohne dass er einen Termin bekommen hat.“ Er berichtete, dass darüber verhandelt werde, dass Klinken künftig auf ein KV-Kontingent zugreifen und direkt Termine in den Praxen buchen können. „Wenn das käme, wäre das ein riesiger Fortschritt“, so ein anderer Teilnehmer der Runde.

Auch hier berichteten Teilnehmer des Gesprächs, dass die Zusammenarbeit zwischen Klinik und KV vor Ort oft gut organisiert sei. Und dennoch, so ein Teilnehmer, laufe die Notaufnahme oft unnötig voll: „Da sind einfach zu viele Patienten, die die Notaufnahme missbrauchen und sich nicht an das halten, was vorgegeben ist.“ Dem widersprachen andere Teilnehmer: „Wir sollten Patienten nicht dafür verantwortlich machen, dass sie sich für einen Notfall halten, auch wenn sich retrospektiv zeigt, dass sie keiner sind. Wir müssen von dem Denken wegkommen, dass Patienten schuld sind.“ Wenn Patienten die Notaufnahme eines Krankenhauses aufsuchen, obwohl dies die falsche Anlaufstelle ist, stimmen die vorgeschalteten Strukturen nicht. Daran müsse man arbeiten.

Personalmangel als zentrales Problem, das sich verschärfen wird
Bereits heute ist der Mangel an qualifiziertem Personal ein großes Problem. So berichteten mehrere Diskussionsteilnehmer, dass Patienten, die in den Notaufnahmen eintreffen, nicht mehr in der Klinik behandelt werden können, weil für die weitere Versorgung nicht ausreichend Personal zur Verfügung steht. Das Problem betrifft sowohl Städte, insbesondere aber auch den ländlichen Raum. Und die Ansprüche der neuen Generation erschweren die Besetzung von Stellen zusätzlich. Umso wichtiger ist eine gezielte Steuerung, sektorübergreifende Versorgung und der Einsatz innovativer Technologien. Denn, so ein Teilnehmer: „Wir haben nicht zu wenig Personal, wir haben eine ineffiziente Versorgung.“

Im Vergleich zum Jahr 1990 gibt es heute doppelt so viele Ärzte. Diese sind jedoch, so eine Befragung des Marburger Bundes aus dem letzten Jahr, ein bis vier Stunden pro Tag mit nichtärztlichen Tätigkeiten wie zum Beispiel Abrechnung und Dokumentation beschäftigt. „Wenn man davon die Hälfte weghätte, könnte man daraus 32.000 Vollzeitstellen einsparen“, so ein Diskutant. Diese Aufgaben müssen delegiert werden an neue Berufsgruppen wie Nurse Practitioner oder Physician Assistants bzw. durch Digitalisierung gelöst werden. Auch eine Konzentration von Klinikstandorten würde das Problem lösen, zeigte sich der Diskutant überzeugt: „Wie kann es zum Beispiel sein, dass in einer Stadt wie Berlin 90 zugelassene Krankenhäuser sind, davon 60 an der Notfallversorgung beteiligt? Das bringt schlechte Qualität und ist Verschwendung von Geld und Personal!“

Der Schlüssel zum Erfolg: die richtigen Finanzanreize
Für die Finanzierung der ILS und der INZ schlägt die Regierungskommission zwei Varianten vor. Entweder sie erfolgt im bestehenden System über die Einführung von Vorhaltepauschalen. Oder es wird ein eigener Topf aus Krankenhausbudget und KV-Budget gebildet. Ein Teilnehmer der Runde warnte dabei jedoch davor, dass so ein neuer, dritter Sektor geschaffen wird. Allerdings ist gerade die Finanzierung der komplex-ambulanten Notfälle weithin noch ungelöst.
Die meisten Teilnehmer waren der Meinung, dass die richtige Incentivierung der Schlüssel zum Erfolg ist. Insbesondere die Zusammenarbeit von ambulantem und stationärem Sektor müsse incentiviert werden, so dass System, Gesellschaft und Patienten profitieren, so ein Diskutant. Ein weiterer forderte, dass das System beweglicher werden muss. Denn werden neue Anreize gesetzt, kann es sein, dass nachjustiert werden muss, um eine Fehlentwicklung zu vermeiden. Dies muss möglich sein.
Ein Teilnehmer der Runde setzte sich dafür ein, nicht Anreize zu setzen, sondern im Gegenteil: „Es muss Sanktionierungen geben, wenn Leute auf der falschen Stufe behandelt werden. Dafür muss man weniger Geld geben statt mehr Anreize.“ Ein anderer Diskutant betonte, dass Incentivierung nicht bedeute, dass mehr Geld ins Gesundheitssystem fließen muss: „Wir haben genug Geld im System. Wir müssen es passend umverteilen.“

Evolution oder Revolution: gehen die Vorschläge der Regierungskommission weit genug?
Die Notfallversorgung ist in vielen Bereichen ineffizient und zu teuer, darüber herrschte Einigkeit in der Runde: „Wir verschleudern Personal in Hamsterrädern, haben ein total ineffizientes System und viel zu viele Klinken, die viel zu viele Dinge machen, die sie nicht machen sollten. Und wir haben unabgestimmte Versorgung zwischen den Sektoren“, so ein Diskutant.
Sehr kontrovers wurde diskutiert, ob die Vorschläge der Regierungskommission weit genug gehen, um die Missstände nachhaltig zu beseitigen. Ein Teilnehmer kritisierte, dass sie die bestehenden Strukturen akzeptieren. Es fehle den vorliegenden Konzepten an Mut und Visionen, an den Strukturen etwas zu ändern: „Es muss nicht alles so bleiben, wie es ist. Wir müssen die Mauer zwischen den Sektoren einreißen.“ Er zeigte sich überzeugt, dass dies gehen würde und man mutiger sein müsse. Man könne nicht Dinge ignorieren, die international mit großer Wucht geschehen. Ihm fehlten im vorliegenden Konzept insbesondere Vorschläge zur Ambulantisierung, „Hospital at home“, Sensorüberwachung, Telemedizin, Cloud und KI. „Ich sehe hier immer noch Bettenburgen und Praxen“, kritisierte er.

Dem hielten andere Diskutanten entgegen, dass die Gesellschaft nicht reformbereit sei. Deshalb müsse man realpolitisch denken, was umsetzbar sein kann. Veränderungen seien schwierig und es gäbe viele Bremser. Ein Teilnehmer betonte: „Solange wir Bundesländer und Kommunalpolitiker mit so viel Einfluss haben, wird das nicht gelingen.“ Aber Durchbrüche gäbe es, wenn Druck steigt – und deshalb würde sich ein Fenster öffnen, in dem vieles möglich wird. Mit der Arbeit der Kommission habe man eine breite Diskussion angestoßen und eine Reform werde definitiv kommen. Nicht zu unterschätzen sei zudem die geplante Einführung der Vorhaltekosten von 60 % der Krankenhauserlöse: „Das ist viel und wir werden riesige Änderungen im Klinikalltag erfahren“, unterstrich er.
Ein Teilnehmer der Runde merkte an: „Je weiter wir von der hektischen Berliner Diskussion fortkommen, desto besser läuft es vor Ort.“ Denn in den einzelnen Regionen werde bereits vieles umgesetzt.